Jerome Kohn
Wir trauern um Jerome Kohn,
der am 9. November 2024 gestorben ist.
Kohn wurde am 28. Juni 1931 in Hartford (Conn.) als Sohn eines Tabakfabrikanten geboren. Er hat an der Universität Harvard Literatur und an der New Yorker Columbia Universität Philosophie studiert, wechselte dann an die New School for Social Research, wo er in den siebziger Jahren Hannah Arendts Assistent wurde.
2022 erhielt er (zusammen mit Roger Berkowitz) den Hannah Arendt-Preis für politisches Denken. 2024 gründete er mit uns die Internationale Hannah Arendt Gesellschaft.
Ich lernte Jerome Kohn 1995 an der New School for Social Research in New York kennen. Zu dieser Zeit war Hannah Arendt bereits 20 Jahre tot. Kohn hatte im Jahr zuvor den ersten von mehreren Bänden mit unveröffentlichten Aufsätzen, Essays und Vorlesungsmanuskripten herausgegeben: Essays in Understanding.
Die vier weiteren Bände, die er bis zu seinem Tod herausbrachte, den letzten im Jahr 2018, haben den Blick auf die Philosophin in den Vereinigten Staaten und auch in Europa maßgeblich beeinflußt. Sie zeigen Hannah Arendt abseits ihrer großen Bücher (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Über die Revolution, Vita activa, Das Leben des Geistes) als Brückenbauerin zwischen der akademischen Philosophie und dem öffentlichen politischen Denken, als Streiterin für den politischen Neubeginn, als begnadete Polemikerin.
Mit seiner Herausgeberschaft machte er Arendts Denken als work in progress zugänglich. Von den vierziger Jahren bis zu den siebziger Jahren konnten nun die Leserinnen und Leser die Entwicklungen, Verästelungen und Brüche ihres Denkens nachverfolgen.
Jerome Kohn ist es maßgeblich zu verdanken, dass Hannah Arendt zu einer weit über die Grenzen der Universitäten hinaus bekannten öffentlichen Person wurde. Bisher unbekannte Texte Arendts wurden nun in Seminaren und Lesezirkeln gelesen; es wurden Doktorarbeiten darüber geschrieben. In Parlamenten wurde die Philosophin seit den neunziger Jahren zitiert und in Festreden gewürdigt.
In den neunziger Jahren gründete Kohn das Hannah Arendt Center an der New School for Social Research, das den digitalisierten Nachlass und eine umfangreiche Sammlung mit Fotos von Hannah Arendt enthielt. 1998 unterstützte er die Gründung eines von mir aufgebauten Hannah Arendt-Zentrums an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, dessen Kern das Archiv des Nachlasses von Arendt in Kopie war. 2009 war er an der Gründung des Hannah Arendt Center am Bard College in Annandale on Hudson (Conn.) unter Roger Berkowitz beteiligt.
2011 übernahm Kohn nach dem Tod von Lotte Köhler das Amt des Bevollmächtigten und Treuhänders des Hannah Arendt/Heinrich Blücher Literary Trust.
Hannah Arendt war für Kohn nicht nur Autorin ihrer Texte. Ihre mitunter provokanten Thesen (siehe die Kontroverse um den Begriff der „Banalität des Bösen“) oder überraschenden Theoremen (z.B. ihre Unterscheidung von politischer und sozialer Sphäre; ihre These von der strukturellen Ähnlichkeit totalitärer Systeme, ihre Imagination des Politischen) waren Teil der Wiederbegründung der Philosophie als Denken in der Mit-Welt.
Kohn gehörte nicht zu den vielen, die dem Verhältnis Hannah Arendts zu Martin Heidegger mit moralischen Verdikten begegneten. Stattdessen interessierte ihn, worüber diese beiden Ausnahmedenker in der Philosophie des XX. Jahrhunderts sich in den Jahren nach 1950 philosophisch und politisch gestritten hatten. Arendts „Denktagebuch“ würdigte er als eine Art philosophischer Röntgenaufnahme von Heideggers Denken und Persönlichkeit.
Jerome Kohn war ein Republikaner im ursprünglichen Sinn, das heisst ein amerikanischer Bürger, der sich als Teil einer politischen Gemeinschaft verstand, für die er mitverantwortlich war. In der Einleitung zum letzten Band seiner Veröffentlichungen aus dem Nachlass Arendts, der bezeichnenderweise den Titel trägt Thinking without a Banister (Denken ohne ein Geländer) gab, hat er den Niedergang der amerikanischen Demokratie und das Auftauchen totalitärer Elemente (wie zum Beispiel die systematische Manipulation der Realität im digitalen Zeitalter) in den Blick genommen. Die amerikanische Gesellschaft sei zum Objekt eines Social Totalism geworden, in dem eine Bürokratie „die mehr oder weniger vollständige Unterdrückung der politischen Freiheit“ und somit auch den Verlust des Politischen mit sich bringe.
Jerome Kohn liebte das offene Gespräch, er schätzte den Austausch von Argumenten und den Streit unterschiedlicher Interpretationen eines Textes. Den akademischen Betrieb nahm er eher besorgt wahr, wohl wissend, dass die Massenuniversität nur in Ausnahmefällen jene Freiheit des Denkens pflegt, der er auf der Spur war.
Jerome Kohn wird uns gegenwärtig bleiben, als dichterisch Denkender und als Freund.
Dezember 2024
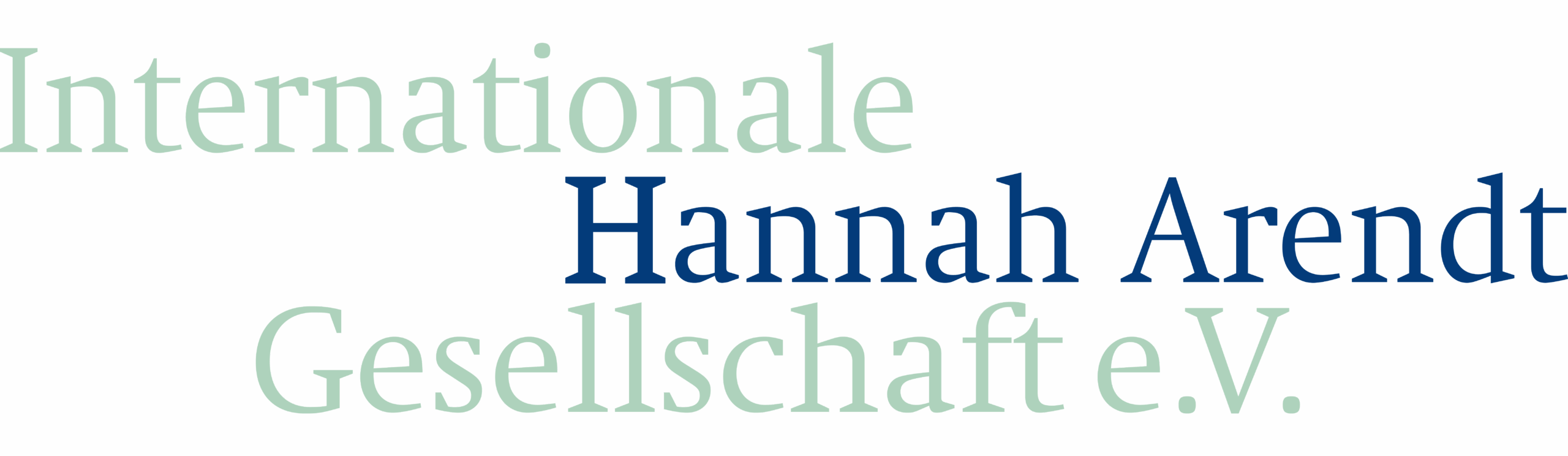
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!